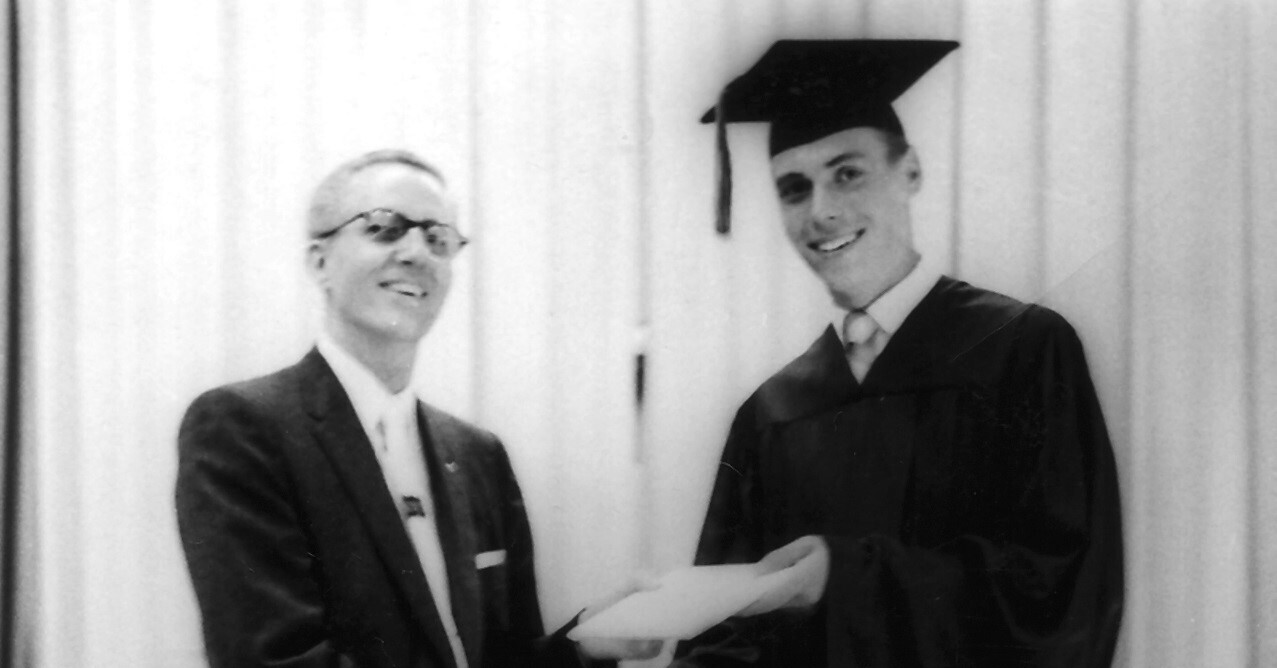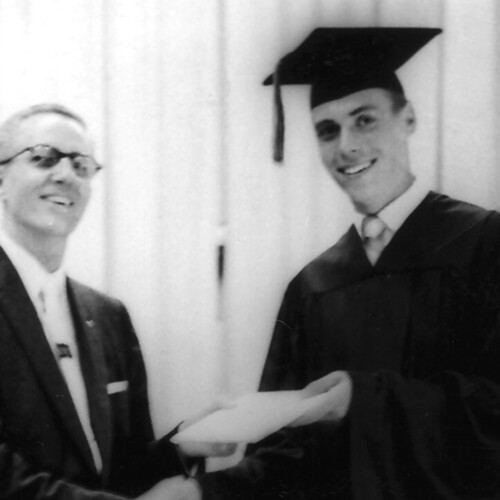In diesem Jahr feiert Dr. Michael Jenne ein besonderes Jubiläum: Vor genau 70 Jahren, im August 1955, begann er als einer der ersten deutschen Austauschschüler ein Schuljahr in den USA – damals noch über den „Michigan Council of Churches“, der später zu Youth For Understanding wurde. Grund genug, im YFU-Blog einen Auszug aus seinem bewegenden Rückblick zu veröffentlichen, den er 2007 für die YFU-Chronik verfasst hat:
„Am 19. Juli 1955 begann für mich das große Abenteuer des Schüleraustauschs, ein gigantisches Unternehmen aus der Perspektive eines sechzehnjährigen Berliners, zehn Jahre nach Kriegsende. Ein Jahr vollgestopft mit Erfahrungen und Eindrücken, die mich deutlich geprägt und viele wichtige Weichenstellungen in meinem späteren Leben bestimmt haben.
Wir feierten das glückliche Los, das wir gezogen hatten, nämlich für ein Jahr das noch immer kriegs- und nachkriegsgeprägte Deutschland mit der Neuen Welt zu vertauschen. Auf dem Schiff kamen wir uns sehr auserwählt vor, was wir ja genau genommen auch waren.
Aufbruch ins Abenteuer
Tatsächlich waren wir herausgefordert, uns mit einer anderen, den bisherigen Lebensgewohnheiten nicht entsprechenden kulturellen, materiellen und sozialen Umwelt auseinanderzusetzen und uns ihr im ganz normalen Alltag weitgehend anzupassen. Das hieß – mit einem heutigen Begriff – einen ziemlich fundamentalen Paradigmenwechsel zu vollziehen.
Der biografische Einschnitt, auf den wir uns mit dem Abenteuer Schüleraustausch eingelassen hatten – später sollten wir ihn, viele von uns jedenfalls, als dementsprechend tief und bedeutend bewerten.
Meine Abhol-Party in Michigan bestand aus etwa einem Dutzend ausschließlich weiblicher Wesen im Alter zwischen fast 3 und 41. Nun begann eigentlich erst so richtig das Abenteuer, das mein Leben nachhaltig verändern sollte: das Abenteuer Austauschjahr.
Eingewöhnung und Ankommen
Wahrscheinlich, weil ich in Berlin das Evangelische Gymnasium besuchte, war ich einer Pfarrersfamilie der „Evangelical and Reformed Church“, einer protestantischen Kirche mit deutschen Ursprüngen, „zugeteilt“ worden. Statt einer nur wenig jüngeren Schwester in Berlin hatte ich nun aber drei, sämtlich im Grundschul- und Kindergartenalter. Am Anfang war es in Mount Clemens nicht ganz einfach gewesen für mich, den Berliner Obersekundaner, der zu Hause jede Woche mindestens einmal ins Konzert pilgerte, um die Philharmoniker oder andere Orchester, berühmte Pianisten und Ensembles zu hören, sich nun in einer Kleinstadt nördlich von Detroit einzuleben.
Doch nach einer ersten Phase der Eingewöhnung war mir klar, dass meine aktive Teilnahme an den diversen kirchlichen Aktivitäten und Veranstaltungen nicht nur von meinen Gasteltern erwartet wurde, sondern dass sich mir in diesem Rahmen ständig Gelegenheiten boten, Menschen zu begegnen, viele ganz normale Leute unterschiedlicher Alters-, Bildungs- und Berufsgruppen näher kennenzulernen und teilzuhaben an einem wesentlichen Bereich des „social life“ in einer amerikanischen Kleinstadt.
Die Gemeinde stellte ein Forum und Zentrum dar für soziale Kontakte beinahe jedweder Art. Ich sang im Chor, war in der Sonntagsschule aktiv, unterrichtete bald selbst eine Gruppe von 9- bis 10-Jährigen. Später zu Hause beim schnell zubereiteten Mittagessen wurde alles erörtert, was wir teils einzeln, teils gemeinsam erlebt hatten.
Schule, Soziales Leben und der „American Way of Life“
Die Schule nahm mich für die folgenden neun Monate reichlich in Anspruch. Neu und ungewohnt war für mich die breite soziale Streuung der Schülerschaft. Aber ich hatte bereits beobachtet, dass Lebensweise und Sozialverhalten deutlich weniger schichtenspezifisch ausgeprägt waren als in Deutschland.
Am „American Way of Life“, mit dem ich mich nun vertraut machte, fiel mir allerdings zunehmend auch die Konformität auf, die ich im sprachlichen Umgang wie in vielen Ausprägungen des „social life“, der Lebensphilosophie und des Tagesablaufs beobachtete. Es war dadurch leicht, in die Gesellschaft hineinzuschlüpfen, Anpassung wurde sogleich mit Lob und Zuspruch honoriert. Andererseits empfand ich als junger Deutscher im Jahre 1955 Skepsis gegenüber allem, was auch nur von ferne nach verordneter oder durch sozialen Druck produzierter Einheitlichkeit roch. Diese Skepsis ließ mich dann gelegentlich innerlich Distanz halten, wenn ich auf übersteigerten Patriotismus und Intoleranz hindeutenden Äußerungen begegnete. Das konnte in der Schule gelegentlich geschehen, sowohl im Unterricht wie auch bei größeren Veranstaltungen. Damals schon hat mich diese Art von Chauvinismus bisweilen irritiert, wenn auch nicht ernsthaft bedrückt.
Was mir auch bald und dann immer wieder auffiel: Jede ein wenig herausragende Leistung wurde mit lobender Anerkennung bedacht – auch von Mitschülern, was ich so nicht kannte. Häme dagegen, die mir als Resonanz auf gute wie auf schwache Leistungen vertraut war, schien es im Ausdrucksrepertoire der Amerikaner nicht zu geben. Man ging dort einfach freundlicher miteinander um.
Da ich einerseits der „senior class“ (Stufe 12) angehörte, die amSchuljahresende mit Pomp und mehrtägigen Festivitäten in der „High School Graduation“ (Abschluss) endete, andererseits aber in zwei Hauptfächern, Englisch und Geschichte, Kurse der „junior class“ (Stufe 11) mitmachte, wurde ich zu meiner Überraschung ganz unabhängig voneinander in beide Gremien gewählt und erfuhr in beiden etwas über praktizierte Basisdemokratie im Bildungssystem der USA. Einiges aus dieser Erfahrung ließ sich durchaus auf deutsche Schulverhältnisse übertragen, was mir nach meiner Rückkehr sogar am Evangelischen Gymnasium gelang, dank einiger pädagogisch progressiv orientierter Lehrer.
Musikalischer Höhepunkt zum Abschied
Bevor ich mit meiner Gruppe Michigan verlassen habe, wieder in einem Greyhound-Bus und fast auf den Tag genau zwölf Monate nach unserer Ankunft, wurde mein Austauschjahr noch von einem Erlebnis ganz besonderer Art gekrönt: Der Lehrerverein meiner High School hatte mich zur Teilnahme an einem zweiwöchigen Kurs, „All State Orchestra“ beim „National Music Camp“ in Interlochen, Michigan, mit Hauptfach Klavier und Nebenfach „Dirigieren“ angemeldet und mir dafür ein Stipendium spendiert – ein gewaltiges Abschiedsgeschenk, wie mir erst allmählich klar wurde.
Etwas mit diesem Music Camp auch nur irgend Vergleichbares gab es damals in Deutschland, ja wahrscheinlich in ganz Europa nicht. Vielleicht war ich vor 70 Jahren der erste deutsche Austauschschüler, dem das Glück widerfuhr, nach Interlochen zu gelangen. Jahre danach und bereits in der Berliner Nachwuchsszene engagiert, konnte ich bei der Entsendung einiger hochbegabter junger Instrumentalisten zum „National Music Camp“ (heute „Interlochen Center for the Arts“) behilflich sein, bis die Kontakte über verschiedene deutsche Organisationen und Einrichtungen liefen. Ich bin überzeugt, dass die Impulse, die ich selbst als Schüler in diesen zwei Wochen erhielt, mich für den Rest meines Lebens wesentlich geprägt haben und schließlich 2021 zu meiner Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz geführt haben.
Rückkehr nach Deutschland
Doch zurück zum Sommer 1956 in den USA, wo mich meine amerikanische Familie nach den zwei Wochen in Interlochen vollzählig mit dem grünen Stationwagon abholte. Am selben Abend nämlich musste ich am Treffpunkt bei Detroit sein, wo meine Gruppe von Austauschschülern des Michigan Council of Churches vor der Abfahrt nach New York übernachten sollte. Nach und nach trafen alle mit ihren Gasteltern und -geschwistern ein, es gab Abschiedszeremonien, dann kehrten die Familien nach Hause zurück – ohne uns. Für die meisten war es ein schwerer, für viele ein beiderseits tränenreicher Abschied. So begann die lange Rückreise, die schließlich am 15. August 1956 vormittags endete, für mich in Berlin-Zehlendorf.
Diese Landung in Berlin hatte etwas vom Erwachen aus einem langen, intensiven Traum, aus dem man sich herausgerissen fühlt. Das Gepäck, das wir bei uns trugen, enthielt natürlich einige Souvenirs – aber meine Siebensachen, in zwei Koffern verstaut, waren leichtgewichtig im Vergleich zu den Mengen an virtuellem Gepäck, das sich als Erfahrungen in mir trug, intellektuell und emotional zum Teil noch gar nicht entwickelt, wie Fotos auf Filmen, die noch nicht entwickelt sind.
Lebensprägende Impulse
In einer der inneren Schubladen lagerten Eindrücke, die ich als meinen ganz persönlichen Gewinn empfand. Es war das beinahe intime Vertrautsein mit einer anderen Soziokultur, das ich als besonderen Gewinn empfand – ohne mir diese Kultur in allen ihren Facetten und Ausdrucksformen hätte zu eigen machen wollen.
Rückschauend glaube ich, dass die meisten von uns damals auf der Rückreise diese Empfindung teilten. Sie war und ist bis heute womöglich der größte Gewinn eines bewusst und intensiv erlebten Schüleraustauschjahres.
Das Austauschjahr mit allen Eindrücken und Erfahrungen hat mir entscheidende Impulse vermittelt und die Leitmotive für mein späteres Leben geprägt: Bildung und Sozialstruktur, Jugendaustausch und internationale Beziehungen, schließlich, aber gewiss nicht an letzter Stelle, die humane Bedeutung und die Vermittlung von Musik.“
Der vollständige Bericht von Dr. Michael Jenne ist 2007 in der YFU-Chronik erschienen. Die Chronik kann bei Interesse in der YFU-Geschäftsstelle angefordert werden.